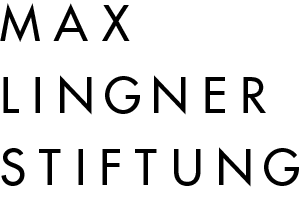Frühjahrsprogramm 2024
Alle unsere Veranstaltungen werden in der Regel auch live gesendet und können anschließend kostenlos in unserem YouTube-Kanal nachgesehen werden. Auf Wunsch senden wir Ihnen das neue Programm per Mail oder, wenn Sie uns einen frankierten und adressierten Briefumschlag zuschicken (Beatrice-Zweig-Straße 2, 13156 Berlin), auch per Post.
Auf Wiedersehen im Max-Lingner-Haus!
Thomas Flierl, Vorsitzender der Max-Lingner-Stiftung
24. April 2024, 19 Uhr
Corporate Identity der DDR
Buchvorstellung von Andreas Koop (Allgäu)
anschließend im Gespräch mit Wilfried Klink
Moderation: Thomas Flierl
Eine Annäherung an die DDR über ihre Selbstdarstellung. Der Designforscher Andreas Koop, der zuvor das visuelle Erscheinungsbild des Nationalsozialismus beschrieben hat («NSCI»), analysiert die visuelle Identität der DDR und rekonstruiert gewissermaßen das Manual des Arbeiter- und Bauern-Staates: Vom Wappen über die Nationalfarben, Schrift/Typografie und Printmedien bis hin zu öffentlicher Inszenierung.
Der Grafikdesigner Wilfried Klink, Schüler von Werner Klemke und Axel Bertram (Kunsthochschule Berlin-Weißensee), langjähriger Grafikchef von TRIALON und damit einer der kundigsten Kampagnen-Gestalter aus dem Osten, beriet Koop.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/arJ5APgcNqQ
8. Mai 2024, 19 Uhr
Mirano Cavaljeti: Auf der Flucht über den Balkan
Die Kindheitserlebnisse eines Sinto-Jungen während der NS-Zeit
Herausgegeben und vorgestellt von Annette Leo
Moderation: Thomas Flierl
Der heute 90jährige Opern- und Operettensänger Mirano Cavaljeti-Richter hat seine Lebensgeschichte niedergeschrieben. Er erzählt von seiner Kindheit in einer Großfamilie von Sinti, die als Komödianten mit dem Wohnwagen durch die kleinen Städte und Dörfer Deutschlands zogen und ihre Varieté-Programme zeigten. 1939 flohen sie vor der nationalsozialistischen Verfolgung über die Grenze nach Italien. In ergreifender Lakonie schildert Cavaljeti die dramatische Odyssee durch Italien, Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien, in deren Verlauf sie nach und nach alles verloren, ihr Leben jedoch retten konnten.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/LSwO1yIlBQ4
Kooperation mit Helle Panke e.V. | Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
15. Mai 2024, 19 Uhr
Architekturvortrag 47
Haus Perls und das Museumsprojekt von Eduard Fuchs
Vortrag von Christian Hufen
Moderation: Thomas Flierl
Das 1911/12 errichtete Haus Perls in Zehlendorf, ein Frühwerk von Mies van der Rohe, gelangte 1918 in den Besitz des Kunstsammlers, Schriftstellers und Linkspolitikers Eduard Fuchs (1870–1940). Für dessen Kunstsammlung entwarf Mies 1927/28 einen modernen Erweiterungsbau – sein erstes Kunstmuseum in Berlin. Als Eduard Fuchs und seine deutsch-jüdische Frau Margarete 1933 ins Exil gingen, zerschlug sich der Plan, ihr gemeinsames «Museum eines Sammlers» der Stadt Berlin zu schenken. Christian Hufen erzählt die Geschichte des Mies-Ensembles und erinnert an das Vermächtnis des Sammlerpaares Fuchs.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/2GKByG-tmSA
22. Mai 2024, 19 Uhr
Stilfragen. Heinrich Wölfflin in der frühen DDR
Vortrag von Oliver Sukrow
Moderation: Thomas Flierl
Noch wenig erforscht ist die Geschichte der Kunst- und Architekturhistoriografie in der frühen DDR. Das betrifft – neben thematischen Neuausrichtungen – auch Fragen nach den Quellen und möglichen Anknüpfungspunkten einer ‹neuen› Kunstwissenschaft nach 1945. Bei der Konzeptualisierung von ‹Stil› und ‹Bedeutung› wurde u.a. auf das Oeuvre des Schweizer Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin (1864–1945) zurückgegriffen, der in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin gelehrt hatte und an dessen Grundbegriffen und an dessen Stiltypologie von der Renaissance zum Barock keine Kunstwissenschaft vorbeikommt.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/ngkkA_rwzkg
Kooperation mit Helle Panke e.V. | Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
5. Juni 2024, 19 Uhr
Architekturvortrag 48
Soviet Mobile Architecture
Vortrag von Ksenija Litvinenko (in englischer Sprache)
Moderation: Thomas Flierl
In der späten Sowjetunion wurde der Versuch unternommen, nomadische Bautechniken für mobile Architekturen zu nutzen, die entweder als temporäre und – potenziell – transportable «Verlege»-Siedlungen dem extraktiven Urbanismus im Zusammenhang mit der Erdöl- und Gasförderung dienten, der kollektivierten Viehzucht oder auch der Erholung der Arbeiter. Ksenija Litvinenko geht es um ein genaues Verständnis der Einbeziehung bautechnischen Fachwissens und architektonischer Praxis in die staatlich geförderte Expansion von Siedlern und Extraktivisten in Westsibirien und die damit einhergehende Verdrängung der indigenen Bevölkerung.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/9igFXQFkXME
19. Juni 2024, 19 Uhr
Architekturvortrag 49
Städtebau im Nationalsozialismus
Dynamik als Realität, Periodisierung als Methode
Vortrag von Harald Bodenschatz
Moderation: Thomas Flierl
Der Vortrag stellt ein fortgeschrittenes Forschungsprojekt vor, das vier Grundthesen folgt: 1. Wie in anderen Diktaturen auch, war die Architektur im NS dem Städtebau untergeordnet. 2. Städtebau wird weit gefasst: umfasst auch Infrastruktur aller Art und die Prägung der Landschaft. 3. Städtebau ist nicht nur ein Produkt, eine Form, er umgreift auch die Produktionsverhältnisse, die Produktionsprozesse und deren Wirkungen und die auf die Produkte bezogene Propaganda. 4. Der NS-Städtebau war einer permanenten Veränderung unterworfen. Seine Dynamik ist nicht nur national erklärbar, sondern erfordert einen Blick auf internationale Ereignisse.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/k76-AiBNd3o