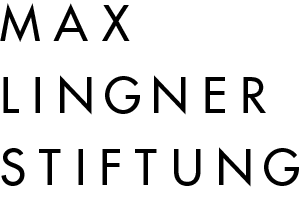15. Februar 2023, 19 Uhr
Genosse Grosz im Land der Sowjets.
Eine Künstlerreise mit Folgen
Vortrag von Christian Hufen
Moderation: Thomas Flierl
Vor genau 100 Jahren besuchte der Berliner Dadaist George Grosz (1893–1959) den ersten sozialistischen Staat. In seiner Autobiografie legte er 20 Jahre später einen ebenso amüsanten wie lückenhaften Reisebericht vor. Verfasst für US-amerikanische Leser und erstmals 1953 in West-Berlin publiziert, verschwieg Grosz darin seine Mitgliedschaft in der KPD wie seine prominente Rolle in der Kommunistischen Internationale. Neuentdeckte Dokumente aus russischen Archiven erlauben eine Rekonstruktion dieser Russlandreise. Der Vortrag präsentiert die wichtigsten Ergebnisse der Recherche und erklärt, warum der KPD-Austritt des Künstlers aufgrund seiner Reiseerlebnisse eine Fiktion des Kalten Krieges ist, die im wiedervereinigten Deutschland gern weitererzählt wurde.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=PRm-engU7wg
22. Februar 2023, 19 Uhr
Architekturvortrag 40
Der Pavillon de la Paix auf der Weltausstellung Paris 1937
Vortrag von Thomas Flierl
Moderation: Christian Hufen
Bis heute wird die Topografie der Weltausstellung 1937 vor allem über die gebaute Konfrontation des sowjetischen und des nazideutschen Pavillons, der Architekturen von Boris Iofan und Albert Speer, gedeutet. Dabei wird übersehen, dass das Raumprogramm des Ausstellungsgeländes eine bedeutungsvolle Längsachse hatte: Dem alles überragenden Eiffelturm stand auf dem erhobenen Plateau der Place du Trocadéro der «Pavillon de la Paix» mit der Friedenssäule gegenüber. Bereits vor Antritt der Volksfront-Regierung unter Léon Blum 1936 war diese Komposition gefunden worden, doch nahm dieser wesentlichen Einfluss darauf, dass die internationale Friedensbewegung die Ausgestaltung des Pavillons übernahm. Der Vortrag erläutert die Baugeschichte und zeigt die Innendekoration des Pavillons, u.a. mit einem Wandbild von Max Lingner.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=FLsv0xMHiyA
In Kooperation mit Helle Panke/Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
15. März 2023, 19 Uhr
Wege ins Offene.
Zum Werk Karl Clauss Dietels
Film von Steffen Schuhmann, Vortrag von Walter Scheiffele
Moderation: Renate Flagmeier
Clauss Dietel ist wie kaum ein Zweiter dem Motiv der Moderne, der Einheit von Kunst und Technik, gefolgt. Sein Ingenieurstudium in Zwickau setzte er mit der Ausbildung zum Industrie-Formgestalter in Berlin-Weißensee fort. Den Weg in die Industrie schlug er als freiberuflicher Gestalter über die Schaltzentralen der Planwirtschaft bis hinein in die Volkseigenen Betriebe fort. Zusammen mit Lutz Rudolph hat er dort einen Großteil ostmoderner Fahrzeuge und Geräte gestaltet. Die Vortragenden werden aus ihren Recherchen im Archiv Dietels berichten: wie der Gestalter im Diskurs mit Konstrukteuren bei Heliradio, Sachsenring, Simson und Robotron zu Formen fand, die Poesie und Funktion in Einklang brachten. Die «offen für das Kommende» sein sollten.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=_b7XC4fE6QU
In Kooperation mit Helle Panke/Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
22. März 2023, 19 Uhr
Im Krieg verlieren auch die Sieger
Buchvorstellung mit Daniela Dahn
Moderation: Christian Hufen
Es ist wieder Krieg in Europa. Und längst geht es nicht mehr um die Frage, ob wir involviert sind, sondern um das Wie. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist die westliche Friedensarchitektur zusammengebrochen. Aber gab es sie denn jemals? Politiker Deutschlands, der USA, der NATO und die Leitmedien erklären unisono, in der Ukraine werde unsere Freiheit verteidigt, deshalb müsse sie siegreich aus dem aufgezwungenen Krieg hervorgehen. Aber geht das überhaupt? Erfüllt unsere Antwort mit Wirtschaftskrieg und Waffenlieferungen den beabsichtigten Zweck? Sind Verhandlungen geeigneter, den Krieg zu beenden?
Börne-Preisträgerin Daniela Dahn präsentiert neue Texte zum Krieg in der Ukraine und solche aus der unmittelbaren Zeit davor: über seine Vorgeschichte, den Maidan, die russischen und die westlichen Positionen. Sie zeigt, dass der Westen Teil des Problems ist.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=d7inBrxf6HE
29. März 2023, 19 Uhr
Jüdisch & links
Buchvorstellung mit Wolfgang Herzberg
Moderation: Christian Hufen
Säkulare, linke deutsche Juden, die nach 1945 zurückkehrten, prägten das politische und kulturelle Leben beider deutscher Staaten. Wolfgang Herzberg argumentiert, dass jüdische Überlebende den Kern einer linken Nachkriegsintelligenz in der DDR bildeten und dort oft konfliktreich die (politische) Kultur prägten. Er schildert dies aus der Innenperspektive seiner jüdischen Familie. Die autobiografischen Berichte seiner Mutter, ehemalige Generalstaatsanwältin, und seines Vaters, Parteijournalist, werden ergänzt durch seine eigene biografische Erzählung. Herzberg war Texter für die Rockband Pankow und vor allem Dokumentarist. Ein Essay über jüdische Remigranten in die DDR verdichtet die biografischen Darstellungen.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=NJgMxT9xD3g
Workshop am 18., 19. und 20. April 2023, jeweils 19 Uhr
Sozialistische Moderne in Mittel- und Osteuropa
Aus Anlass des Internationalen Denkmaltags am 18. April 2023
International ist ein neues Interesse an der «zweiten sozialistischen Moderne» (seit 1955) in Architektur und Städtebau zu beobachten. Vor allem die Aufarbeitung des Kalten Krieges im angelsächsischen Raum trug dazu bei. Kürzlich veröffentlichte Łukasz Stanek sein Buch Architecture in Global Socialism (2020). In Europa waren zweifellos die Ausstellung im Wiener Architekturzentrum Sowjetmoderne 1955–1991 (2012/13) und der sie begleitende Katalog ein wesentlicher Meilenstein für diese Neuentdeckung. Auch in den osteuropäischen Ländern wächst das Verständnis, dass es über die Rezeption der Zwischenkriegsmoderne hinaus, dort zum Teil als Ressource des Wiederentstehens der Nationalstaaten begriffen, auch darauf ankommt, die sozialistische Phase als Teil der eigenen Baukultur zu thematisieren.
In Osteuropa haben die Beiträge von Dumitru Rusu und der B.A.C.U.-Vereinigung bemerkenswerte Resonanz gefunden. Mit seinen Fotobänden, Architekturführern und der Website Socialist Modernism haben der rumänische Architekt und sein Team die Kenntnis über die Architekturen der ehemals sozialistischen Länder in den letzten Jahren stark befördert. Parallel hat sich im Rahmen des 2006 in Moskau gegründeten Internationalen Wissenschaftlichen Komitees von ICOMOS für das 20. Jahrhundert eine Plattform SocHeritage etabliert.
Die Wiederkehr militärischer Auseinandersetzungen in Europa und schließlich der Überfall Russlands auf die Ukraine im Frühjahr 2022, der Einzug eines neuen Blockdenkens und das Erstarken nationalistischer Strömungen gefährden diesen Austausch und die damit in Gang gekommene Aufklärung über die gemeinsame jüngere Geschichte. Anlässlich des Internationalen Denkmaltags von ICOMOS am 18. April haben wir Dumitru Rusu und ausgewiesene Fachleute aus Mittel- und Osteuropa eingeladen, um in einem Workshop dieses geteilte kulturelle Erbe zu erörtern und über den Krieg hinaus den grenzüberschreitenden Dialog zu befördern.
In Kooperation mit ICOMOS Deutschland, BTU Cottbus, Helle Panke/Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin und der Hermann-Henselmann-Stiftung
18. April 2023, 19 Uhr
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Videos vom Workshop, auf denen Sie zu erkennen sein könnten, zur Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.
Please note that photographs and videos of the workshop in which you may be recognisable will be published for the purpose of documenting the event. With your participation you agree to this.
Dumitru Rusu (Bukarest) stellt das Projekt «Socialist Modernism» und insbesondere die Bände zu Bulgarien, Ex-Jugoslawien und zum Baltikum vor.
Begrüßung: Thomas Flierl
Grußwort: Tino Mager (ICOMOS Deutschland)
Diskussion mit (angefragt) Riin Alatalu (Tallin), Danica Petrovic (Zagreb/Cottbus), Emilia Kaleva (Sofia), Sandra Uskokovic (Dubrovnik) etc.
Moderation: Jörg Haspel
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtu.be/7_thetd1vk8
19. April 2023, 19 Uhr
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Videos vom Workshop, auf denen Sie zu erkennen sein könnten, zur Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.
Please note that photographs and videos of the workshop in which you may be recognisable will be published for the purpose of documenting the event. With your participation you agree to this.
Dumitru Rusu (Bukarest) stellt die Bände zur Ukraine und zu Russland vor.
Diskussion mit (angefragt) Pavlo Kravchuk (Zaporizhzhja), Yevheniia Molyar (Kiïv/Rom), Vitaly Shulyar (L‘viv), Svitlana Smolenska (Char’kiv/Berlin) und Natal‘ja Duškina (Moskau) etc.
Moderation: Jörg Haspel
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=arFxEfxY10w
20. April 2023, 19 Uhr
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos und Videos vom Workshop, auf denen Sie zu erkennen sein könnten, zur Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.
Please note that photographs and videos of the workshop in which you may be recognisable will be published for the purpose of documenting the event. With your participation you agree to this.
Dumitru Rusu (Bukarest) stellt den Band «Sozialistische Moderne in Deutschland» vor.
Was ist «sozialistische Moderne»? Zum Stand der Debatte. Perspektiven von Denkmalforschung, Denkmalpflege und Denkmalrestaurierung, Architektur- und Städtebau-Theorie und -Geschichte
Diskussion mit Kirsten Angermann (Weimar), Uta Pottgießer (Detmold/Delft), Andreas Putz (München), Johanna Blokker (Cottbus) und Jörg Haspel (Berlin)
Moderation: Thomas Flierl
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=UGgBi0n5rDQ
3. Mai 2023, 19 Uhr
Bittere Brunnen: Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution
Regina Scheer stellt ihr neues Buch vor
Moderation: Christian Hufen
Hertha Gordon-Walcher (1894–1990) ist heute nahezu unbekannt wie viele Frauen, die ihr Leben im 20. Jahrhundert der sozialen Revolution gewidmet haben. Schon seit 1915 war sie im Spartakusbund, 1918 arbeitete sie im Kreml, erlebte die Revolution, die sich anders gestaltete als in ihren Träumen. Sie war Sekretärin von Clara Zetkin, Kurierin der Komintern, Redakteurin im Malik-Verlag. 1928 aus der KPD ausgeschlossen, trat sie nach dem Exil in Paris und New York 1947 in die SED ein, wollte den Sozialismus mit aufbauen. Bei ihrer Beerdigung sagte der Brecht-Biograf Werner Mittenzwei, von ihr könnten wir lernen, wie man mit Niederlagen umgeht.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=zzjBqqrCm7M
10. Mai 2023, 19 Uhr
Das Zentrum für Kunstausstellungen der DDR 1973–1990
Vortrag von Hans-Jörg Schirmbeck
anschließend im Gespräch mit Christian Saehrendt
Das ZfK konzipierte und realisierte nichtkommerzielle Ausstellungen auf der Grundlage zwischenstaatlicher Kulturabkommen. Der Mitte der 1970er beginnende intensive Kunst-Austausch förderte die internationale Anerkennung der DDR und stärkte die Bedeutung der Künstler im Inland. Aus der Ausstellungsgruppe des Kulturministeriums hervorgegangen, 1973 per Gesetz gegründet, arbeitete das ZfK vergleichbar dem Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, in dessen Besitz Teile der 1990 aufgelösten DDR-Institution übergingen. Der Vortrag beleuchtet die Stellung und die Arbeitsweise des ZfK im «System Kunst» der DDR.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=AfwVe8e4Hyk
17. Mai 2023, 19 Uhr
Und der Zukunft zugewandt
Swetlana Schönfeld im Gespräch mit Helga Kurzchalia,
mit Ausschnitten aus Filmen und von Theaterarbeiten
Swetlana Schönfeld, die seit vielen Jahren erfolgreiche Film- und Theaterschauspielerin (u. a. Maxim-Gorki-Theater, Deutsches Theater, Schaubühne, Berliner Ensemble), ist 1951 in einem Lager im Gebiet Kolyma zur Welt gekommen. Bernd Böhlichs Film «Und der Zukunft zugewandt» (2019) basiert auf der Geschichte ihrer Mutter, einer deutschen Kommunistin, die aus Nazideutschland geflüchtet war und in der Sowjetunion 25 Jahre im Gulag verbrachte. Bei ihrer Übersiedlung in die DDR (1957) musste die Mutter sich verpflichten, über ihre Zeit im Gulag zu schweigen. Wie hat Swetlana Schönfeld die Tabuisierungen im DDR-Alltag erlebt? Wie schaut sie heute auf die Welt?
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=0jxRNswKvPw
Da es während der Tonübertragung aufgrund einer fehlerhaften Steckdose im Veranstaltungsraum selbst Tonprobleme gab, für die wir uns bei den Anwesenden vielmals entschuldigen, wurden die Filmausschnitte nicht vollständig gezeigt. Das Video wurde daher nachträglich bearbeitet und um die fehlenden Filmaufnahmen ergänzt. Diese Fassung kann hier angesehen werden: https://youtu.be/7uLtDEq1KyI
In Kooperation mit Helle Panke/Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
7. Juni 2023, 19 Uhr
Achtung Programmänderung:
Der Vortrag über Kurt Meyer wurde von den Referentinnen leider kurzfristig abgesagt. Dank an Nils Exner, dass er uns seinen aktuellen Vortrag hält!
Architekturvortrag 41
Fred Forbat und Werner Hebebrand
Die Reintegration einer (west-) deutschen Gruppe in die CIAM 1946–1959
Vortrag von Nils Exner
Moderation: Thomas Flierl
Nach Walter Gropius‘ Emigration 1934 hatte es innerhalb der CIAM (dt.: Internat. Kongresse Moderner Architektur) keine anerkannte deutsche Sektion mehr gegeben und die in Deutschland verbliebenen Architekten waren nach 1945 zunächst isoliert. Der Vortrag beleuchtet die komplexen Bemühungen um Wiedereinbindung und nimmt die hierfür zentralen personalen Verbindungen zwischen (west-) deutschen und schwedischen Akteuren in den Blick. Nachdem schließlich 1952 nochmal eine deutsche Gruppe konstituiert worden war, sollte es im Rahmen der Berliner Interbau 1957 schließlich zur ersten Zusammenkunft der CIAM in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg kommen.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=UW_rPKXk_QU
14. Juni 2023, 19 Uhr
Architekturvortrag 42
Dieter Bankert – Architekt, Zeichner, Maler, Poet, Optimist, Zweifler, Visionär.
Dokumentarfilm von Jürgen Prange (2022), danach Gespräch mit Dieter Bankert
Moderation: Peter Meyer und Andreas Sommerer
Dieter Bankert war maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher Bauten, vor allem in Berlin, beteiligt. Er hat einen ganzen Kosmos an Veranlagungen zur Verfügung, die er nutzt und pflegt, mit Freude und Hingabe, mit unglaublicher Energie. «Er vertritt die Grundhaltung, dass Form, Funktion und Struktur nur in ihrer dreifachen Einheit die Gegenstände vollständig beschreiben.» (Anne-Barbara Sommer, 2009) Immer wieder bringt er seine Ideen zu Papier, die begeistern oder irritieren. Beides kann er aushalten. Wer ihm begegnet, wird angeregt und gewinnt Selbstvertrauen und vergisst das nicht. Der Film skizziert sein Werk, lässt ihn zu Wort kommen. Das Gespräch mit ihm führt weiter.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=-j8F-AWfIE4
13. September 2023, 19 Uhr
Vermutlich Deutscher
Ein Gespräch zwischen Hazel Rosenstrauch und Vincent von Wroblewsky über dessen gerade veröffentlichte Biografie
Die Aufzeichnungen des Philosophen, Dolmetschers und Übersetzers Vincent von Wroblewsky geben unter Verwendung von Urkunden, Briefen und anderen Dokumenten einen Einblick in das Leben eines «staatenlosen» deutsch-französischen Migranten. Geboren 1939 als Sohn eines emigrierten jüdischen Kommunisten und seiner Frau, kam Vincent von Wroblewsky in den 1950er Jahren nach Ost-Berlin, seine Mutter wirkte dort nach dem Krieg als überzeugte Kommunistin am Aufbau der DDR mit. Die über Jahre entstandenen Aufzeichnungen ergeben das Porträt eines Individualisten oder, wie er selbst sagt: die «ungehaltene Dankesrede eines zur Freiheit verurteilten, in Frankreich geborenen gottlosen Juden.»
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/zMz4PYTbEuU
20. September 2023, 19 Uhr
Das Leben schreiben
Warlam Schalamow: Biografie und Poetik
Lesung und Buchvorstellung mit Franziska Thun-Hohenstein
Moderation: Wladislaw Hedeler
Die ersehnte Anerkennung blieb dem Schriftsteller Warlam Schalamow zeitlebens versagt. Sein Hauptwerk, dass das Geschehen in den Zwangsarbeitslagern des Gulag am Kältepol der Erde reflektiert, erschien posthum nach Auflösung der Sowjetunion. Schalamow lebte in einer von Brüchen und Verlusten gezeichneten Zeit russischer Geschichte, in der sich kaum jemand der bedrohlichen Macht der Politik zu entziehen vermochte. Zum Widerstand wurde ihm dabei die Dichtkunst. Franziska Thun-Hohenstein erzählt in der ersten umfassenden Biografie fesselnd vom Leben und Werk Schalamows, ohne sie einer einfachen Entwicklungslogik unterzuordnen.
Leider konnte wegen Krankheit unseres Mitarbeiters keine Aufzeichnung gemacht werden. Wir bemühen uns, demnächst hier einen Tonmittschnitt anzubieten.
Kooperation mit Helle Panke/Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
27. September 2023, 19 Uhr
Alfred Kurella und «Der Leopard»
Eine interessante Editionsgeschichte
Vortrag von Bernardina Rago (Bari, Italien)
Moderation: Reinhard Griebner
Zum 100. Jahrestag des Risorgimento, der Bewegung zur Einigung Italiens, die vor allem mit dem Namen von Giuseppe Garibaldi verbunden ist – erschien 1961 in der DDR der Roman Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957). Es war das einzige Buch des Angehörigen eines der ältesten sizilianischen Adelshäuser und erschien in Italien postum 1958. Wie die Literaturhistorikerin Bernardina Rago herausfand, ging die Herausgabe des Werkes in der DDR auf die schwärmerische Leidenschaft von Alfred Kurella für das Buch zurück. Für ihn war es eine gelungene Darstellung des Kampfes zwischen Altem und Neuen in der Gesellschaft. Die Autorin beleuchtet diese besondere Editionsgeschichte.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/HP8wIQeKXno
11. Oktober 2023, 19 Uhr
«Das Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit»
Michael Bulgakow und sein Jahrhundertroman «Der Meister und Margarita»
Vortrag von Michael Leetz
Moderation: Thomas Flierl
Bis an sein Lebensende arbeitete Michail Bulgakow (1891–1940) an «Der Meister und Margarita». Als der Roman ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod erstmals erschien, war das eine literarische und politische Sensation. Aus verdrängter Vergangenheit tauchte ein Schriftsteller auf, der die Widersprüche der Sowjetunion satirisch-heiter durchschaubar machte und ewige Menschheitsfragen neu gestaltete. In der Lesung werden zentrale Szenen vorgestellt und die tieferen Gedanken wie auch die historischen Hintergründe des Romans erhellt.
Auf Wunsch des Vortragenden verzichten wir auf die Aufzeichnung der Veranstaltung.
18. Oktober 2023, 19 Uhr
Angela Fensch: Porträt-Trilogien 1988/2004/2022
Fotos, Buchvorstellung, Gespräch
Moderation: Thomas Knauf
So mutig, so stark und so schön wie möglich sollten die Frauen aussehen, die Angela Fensch 1988 das erste Mal zusammen mit ihren Kindern in der DDR porträtierte. Dabei reduzierte sie die Frauen nicht auf ihre Mutterrolle, sondern zeigte sie zugleich in ihrer Weiblichkeit, betonte ihre Individualität und ihren Anspruch auf Selbstverwirklichung. Die 1989 erschienene erste Porträtserie »Kind Frau« gehört zu den bedeutenden künstlerischen Zeugnissen weiblicher Emanzipation in der DDR. Fünfzehn Jahre später sah Angela Fensch erstmals nach, was aus den Frauen und ihren inzwischen erwachsenen Kindern geworden ist. Nun, nach dreißig Jahren deutscher Einheit, hat sie sie ein drittes Mal fotografiert.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/euC3HBcsPbA
1. November 2023, 19 Uhr
Stephan Hermlin: Entlang eines Dichters
Hans-Dieter Schütt stellt sein neues Buch vor
Moderation: Thomas Flierl
Hermlin (1915–1997) war einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR. Als Jugendlicher hätte er wohl auch Klosterschüler werden können, wurde aber Jungkommunist. Er hätte als Dichter früh zu Ernst Jünger finden können, den er zeitlebens für einen Großen hielt, aber er fand zu Thälmanns Partei. Der Gedanke der Selbstverbesserung wich dem besseren Gedanken: die Welt zu ändern. Auf bewegende Weise spiegelt sein Leben den Aufschwung wie das Scheitern einer politischen Idee. Hermlin lebte den Widerspruch zwischen geistigem Adel und der Bereitschaft zu soldatischer Fügung. Ein linker Aristokrat, der sich mit Selbststilisierung schützte – und angreifbar machte.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/rWMxJtECE1w
Kooperation mit Helle Panke/Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin
5. November 2023, 14 bis 19 Uhr
Dem Bildhauer Michael Klein zum Achtzigsten
Bilder, Skulpturen, Geschichten und Gespräche
Das bildhauerische Werk Michael Kleins ist nicht nur eng mit seiner Liebe zu Berlin und dessen Geschichte verbunden, sondern auch mit seiner Biografie und seinen Wegbegleiter. Seine Skulpturen erschuf er allein im Atelier und doch waren viele unterstützende Hände und beratende Köpfe nötig, um seine Projekte zu realisieren: Kollegen, Gießer, Architekten, Statiker, Ingenieure, Bauamtsleiter, Kunsthistoriker, Grafiker, Fotografen, Förderer, Gefährten, Familie, Freunde. Seine Tochter Anna-Maria Weber lädt zu einem Nachmittag des gemeinsamen Erinnerns bei Kaffee und Kuchen ein.
15. November 2023, 19 Uhr
Architekturvortrag 43
Das Neue Frankfurt – Welterbe?
Vortrag von Wolfgang Voigt (Frankfurt am Main)
Moderation: Thomas Flierl
Nicht nur Berlin, auch Frankfurt am Main bewirbt sich mit einem Projekt der Moderne um einen Platz auf der neuen deutschen Vorschlagsliste zum UNESCO-Welterbe. Frankfurt nominierte die beiden sich am Nidda-Tal gegenüberliegenden Siedlungen Römerstadt und Höhenblick. Beide wurden als Teil des Neuen Frankfurt von Ernst May geplant und zwischen 1925 und 1933 gebaut. Sie modellierten die Peripherie der Stadt völlig neu. Die «Trabantenstadt» war in den 1920er-Jahren ein in aller Welt diskutierter und in Frankfurt realisierter Ansatz, den traditionellen Gegensatz von Stadt und Land aufzuheben, die Wohnfunktion mit einem eigenem Erwerbs- und Versorgungsbereich und mit dem «Grüngürtel» als Naherholungsgebiet zu verbinden.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/In6KBmSSwkQ
29. November 2023, 19 Uhr
Architekturvortrag 44
Nach der Moderne – Die nationalsozialistische Architektur
Ulrich Hartung stellt sein neues Buch vor
Moderation: Thomas Flierl
Hartungs Analyse nazistischen Bauens macht dieses als «Repräsentation» wie als «Realisierung» der rassistisch-hierarchischen NS-Ideologie kenntlich. Sie beendet die Epoche der Verharmlosung beider. Die «Kontinuitätstheorie», als Verurteilung der Moderne pure Ersatzhandlung, wird selbst verurteilt, die Kritik auf den historischen Gegenstand zurückgelenkt. Das Buch arbeitet den Zusammenhang zwischen «Bauten des Glaubens» und denen «der Gemeinschaft» als Rangabstufung von «Blut» und «Boden» heraus, stellt die verbindende Ideo-Logik von «Führertum» und «Volksgemeinschaft» dar. Untersuchungen gelten dem Hakenkreuz im Alltags-Bauen ebenso wie der KZ-Architektur.
Das Video der Veranstaltung kann hier kostenlos angesehen werden: https://youtube.com/live/CHhgNfWNNfI